Praxis & Wissen
Das Fallportal bietet für Studium, Lehre und Forschung
unterstützende Angebote zu kasuistischer Praxis
Praxis & Wissen
- Was ist Kasuistik? Differenzierung kasuistischer Formate und Zugänge, Fallverständnisse, Begründung für Kasuistik in Studium & Weiterbildung
- Praxis der Fallarbeit Beobachtung & Erhebung, Aufbereitung der Daten, Auswertung & Fallanalyse, Forschungswerkstätten & Workshops
- Unterstützung kasuistischer Lehr-Lern-Formate Leitfäden, Seminarkonzeptionen, Materialien aus der Lehre
- Literatur zu Kasuistik Hinweise zu Fallanthologien, kasuistischen Lehrbüchern und Forschung zu Kasuistik
Wissen über Kasuistik
Was ist pädagogische Kasuistik?
Pädagogische Kasuistik – auch als Fallarbeit bezeichnet – ist ein methodisches Vorgehen zur Analyse und Reflexion konkreter Daten oder auch ‚Fälle‘ aus der Praxis pädagogischer Handlungsfelder.
Die Auseinandersetzung mit Datenmaterial aus der konkreten Praxis ermöglicht neue Perspektiven, die zur Förderung professioneller Urteilskraft und pädagogischer Reflexion beitragen können. Besonders in den Bereichen Soziale Arbeit, Sozialpädagogik und Lehrer:innenbildung gehört Fallarbeit inzwischen fest zum methodischen Repertoire des Studiums, der Ausbildung und der Berufsausübung.
Kasuistik zwischen Wissenschaft und Forschung
Pädagogische Kasuistik ist eng mit qualitativ-rekonstruktiver Forschung verbunden. Beide Verfahren:
- sind durch einen Einzelfallbezug gekennzeichnet,
- gehen von einer vorinterpretierten Wirklichkeit aus und
- nutzen empirisches Material aus der pädagogischen Praxis.
Während qualitativ-rekonstruktive Forschung und Kasuistik ähnliche methodische Zugänge zum Einzelfall nutzen, unterscheiden sie sich hinsichtlich ihrer primären Zielsetzung:
- Die Forschung zielt primär auf Erkenntnis- und Theoriebildung. Ihr Erkenntnisinteresse richtet sich darauf, aus dem Einzelfall Muster und Strukturen zu extrahieren, um zu abstrahierten Ergebnissen zu gelangen und so aus der Empirie heraus Wissen zu generieren.
-
Die Kasuistik – verstanden als hochschuldidaktisches Konzept – soll hingegen der Professionalisierung pädagogischer Akteur:innen dienen. Das Ziel ist weniger die Hervorbringung theoretischen Wissens, sondern die Stärkung professioneller Handlungsfähigkeit und die Einübung einer
reflexiven Grundhaltung.
Unter dem Begriff Kasuistik versammeln sich ganz unterschiedliche Ansätze, die als kasuistische Formate bezeichnet werden. Diese variieren je nach Disziplin, konkreter Zielsetzung und Datengrundlage und bewegen sich auf einem Kontinuum: Unterschieden werden kann, ob die Fallarbeit in ihrer Ausrichtung
- eher praxisorientiert ist und damit auf eine Intervention in der pädagogischen Praxis zielt, oder
- ein erkenntnisorientiert-forschungsbezogenes Interesse verfolgt und damit stärker auf ein verstehendes Erkenntnisinteresse hin ausgerichtet ist.
Während qualitativ-rekonstruktive Forschung und Kasuistik ähnliche methodische Zugänge zum Einzelfall nutzen, unterscheiden sie sich hinsichtlich ihrer Zielsetzung:

Oftmals werden diese beiden Perspektiven verbunden – Kasuistik wird so zur Schnittstelle zwischen pädagogischer und wissenschaftlicher Praxis.
Die Vielfalt kasuistischer Formate
Die Zielsetzung und Einbettung in bestimmte Kontexte (pädagogische Praxis, Lehre im Rahmen des Studiums, Aus- und Weiterbildung, Forschung) bestimmt, auf welche Weise empirisches Material dazu beiträgt, Verstehens-, Reflexions- und Interventionsprozesse zu gestalten.
Die Ausgestaltung von Kasuistik variiert je nach Disziplin und Format, sodass es nicht die eine Kasuistik gibt. Kasuistische Verfahren unterscheiden sich je nach:
- Disziplin (z. B. Schulpädagogik, Fachdidaktik, Soziale Arbeit, Sozialpädagogik, …)
- Fallverständnis (Was wird zum Fall gemacht? Z. B. Interaktionssituation, Klientel, …)
- Datengrundlage (Welche Materialien liegen der Fallanalyse zu Grunde? Z. B. Transkripte, Dokumente, Videos, …)
- Methodische Zugänge (Wie ist das Vorgehen der Fallanalyse?)
Im Halleschen Fallportal wird dabei besonders folgende Unterscheidung berücksichtigt:
- erziehungswissenschaftlich-fachdidaktische und auf den Kontext Schule bezogene Fallarbeit
- sozialpädagogische Fallarbeit, die im Sinn von Casemanagement/-work bzw. Einzelfallarbeit in den Arbeitsfeldern der Sozialpädagogik und Sozialen Arbeit angesiedelt ist
Weiterführende Literatur
Einführungen zu Kasuistik in Schulpädagogik, Fachdidaktik, Sozialer Arbeit und Sozialpädagogik
Ader, S., & Schrapper, C. (2022).
„Handwerkszeug und Haltung“ – Fachliche Hintergründe und methodische Zugänge zur Fallarbeit. In S. Ader & C. Schrapper (Hrsg.), Sozialpädagogische Diagnostik und Fallverstehen in der Jugendhilfe (S. 41–97). Ernst Reinhardt Verlag.
Braun, A., Graßhoff, G., & Schweppe, C. (2024).
Sozialpädagogische Fallarbeit. Ernst Reinhardt Verlag.
Kunze, K. (2020).
Kasuistische Lehrerinnen- und Lehrerbildung. In C. Cramer, J. König, M. Rothland & S. Blömeke (Hrsg.), Handbuch Lehrerinnen- und Lehrerbildung (S. 681–690). Klinkhardt.
Wernet, A. (2023).
Hermeneutik – Kasuistik – Fallverstehen: Eine Einführung (2. Aufl.). Kohlhammer.
Wittek, D., Rabe, T., & Ritter, M. (Hrsg.). (2021).
Kasuistik in Forschung und Lehre: Erziehungswissenschaftliche und fachdidaktische Ordnungsversuche. Verlag Julius Klinkhardt.
Kasuistische Formate & Zugänge
Es gibt nicht die eine Kasuistik, sondern eine Vielzahl an Formaten, die unter dem Begriff Kasuistik subsumiert werden können. Vorgestellte Systematisierungen sind dabei idealtypisch zu denken. In der Praxis liegen häufig Mischformen vor, sodass die eröffneten Differenzierungen als Orientierung und Impulse dienen können.
Zwei grundlegende Perspektiven: Akteur:innen- und Klient:innenorientierung
Den nachfolgenden Ausführungen liegt eine etablierte Differenzierung zweier Grundformen kasuistischen Arbeitens zugrunde (Wernet, 2023), die disziplinunabhängig als eine Unterscheidungsdimension kasuistischer Zugänge verstanden werden kann:
Akteur:innenorientierte Kasuistik
Pädagogisches Handeln als soziale Praxis wird zum Fall gemacht. Diese Form ist typisch für schul- und lehrer:innenbildungsbezogene Kontexte.
Fokus: berufliches Handeln und damit einhergehende Herausforderungen und deren Analyse
Klient:innenorientierte Kasuistik
Die Adressat:innen pädagogischen Handelns werden zum Fall. Diese Form ist typisch für sozialpädagogische/ sozialarbeiterische Kontexte.
Fokus: komplexe Lebenslagen, Krisensituationen und Fallkonstellationen, die sich bereits in der Praxis ergeben
In der akteur:innenorientierten Kasuistik wird meist das berufspraktische Handeln und die damit verbundenen Herausforderungen berücksichtigt. Die Fallanalyse dient dazu, zu einem Verstehen der Situation in ihrer Vollzugslogik beizutragen. Erst durch die Auseinandersetzung mit den Daten und dem analysierenden Blick wird der Fall forschungslogisch konstituiert. Dieser Form der Fallarbeit ist insbesondere in der Lehrer:innenbildung dominant, wobei hier natürlich ebenfalls die Möglichkeit besteht, dass sie in sozialpädagogischen Kontexten genutzt werden kann.
Bei der klient:innenorientierten Kasuistik ist der Ausgangspunkt meist ein praktischer Handlungsdruck, etwa eine Krise oder eine komplexe Problemlage. Der Unterschied zur akteur:innenorientierten Kasuistik liegt also auf der Ebene, auf der der Fall entsteht: Hier existiert der Fall bereits in der pädagogischen Praxis und wird nicht erst – wie in der akteur:innenorientierten Kasuistik – durch eine forschungslogische Analyse geschaffen. Diese Form der Kasuistik ist typisch in sozialpädagogischen und sozialarbeiterischen Bereichen.
Diese Unterscheidung ist eng verbunden mit disziplinären Unterschieden – auch hier handelt sich wieder um idealtypische Abgrenzungen:
Erziehungswissenschaftliche und fachdidaktische Zugänge
In der Lehrer:innenbildung ist besonders eine akteur:innenorientierte Kasuistik weit verbreitet, da die komplexen Bedingungen des beruflichen Handelns ein zentraler Aspekt universitärer Lehre sind. Wird der Fokus jedoch bspw. auf einen einzeln:e Schüler:in gelegt und diese:r zum Fall gemacht, können auch Formen einer klient:innenorientierte Kasuistik vorliegen.
Prinzipiell können in Bezug auf das pädagogischen Feld Schule v. a. zwei fachdisziplinäre Zugänge kasuistischen Arbeitens unterschieden werden, die hier gemeinsam als erziehungswissenschaftlich-fachdidaktische Fallarbeit gefasst werden:
- Fachdidaktische Kasuistik betrachtet v. a. konkrete Lernsituationen, Unterrichtsprozesse, Schüler:innenäußerungen mit Blick auf fachspezifisches Lernen.
- Erziehungswissenschaftliche Kasuistik fokussiert stärker auf schulpädagogische, überfachliche Aspekte und Interaktionssituationen, wie z. B. die Herstellung von Unterrichtsordnung, Klassendynamik, Erziehen, usw..
Oft lässt sich ein und dasselbe Datenmaterial aus beiden disziplinären Perspektiven interpretieren. Entscheidend ist, welche Fragen an das Datenmaterial gestellt werden und wie mit dem Material gearbeitet wird.
Ein Systematisierungsvorschlag idealtypischer kasuistischer Arbeitsformen und Formate in der Lehre findet sich bei (Schmidt et al., 2019):
Subsumtive Kasuistik
Hier wird ein Fall genutzt, um eine Theorie oder ein wissenschaftliches Phänomen zu illustrieren. Es geht darum, die Theorie oder das Phänomen im Fall wiederzuerkennen.
Problemlösende Kasuistik
Gegenstand der Auseinandersetzung ist ein ‚problematischer‘ Fall, z. B. eine als problematisch erlebte Situation aus dem Unterricht. Ziel der Fallarbeit ist es, das Problem zu verstehen und Lösungen zu entwickeln.
Praxisanalysierende Kasuistik
In dieser Art von Kasuistik geht es darum, Situationen aus der Praxis mit einem bestimmten (z. B. fachdidaktischen) Fokus zu analysieren. Didaktisches Ziel ist es, diese Praxis zu verstehen, zu bewältigen und zu verbessern.
Rekonstruktive Kasuistik
Hier geht es um ein Nachvollziehen von Situationen, das nicht auf Praxisbewältigung abzielt, sondern unabhängig davon zu verstehen versucht, was eigentlich in dieser Situation passiert.
Neben diesem Vorschlag gibt es in der Literatur eine ganze Reihe weiterer Systematisierungsvorschläge zu Kasuistik, die deutlich machen, wie groß die Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten der Arbeit an Fallmaterial ist.
Multiperspektivische Fallarbeit
Im Bereich sozialpädagogischer Fallarbeit ist v. a. eine klientenorientierte Form der Fallarbeit dominant. Sie geht von komplexen Lebenslagen und spezifischen Fallkonstellationen aus, die meist bereits als Fall in der pädagogischen Praxis wahrgenommen werden.
Etabliert ist in diesem Bereich das Konzept der Multiperspektivische Fallarbeit, bei der unterschiedliche Zugänge zum Fall systematisiert werden (Müller, 2017, S. 43–69).
Bearbeitet werden verschiedene Dimensionen eines Falls:
Fall von
hier geht es um die Sachaspekte, also das Fachwissen der Professionellen, wobei auch die ‚bürokratische‘ Eingebundenheit bedeutsam ist. Dabei gilt es, herauszufinden, welche Sachaspekte für den Fall relevant sind und wie diese, ggf. auch gegeneinander, abzuwägen sind. Ein Fall ist dann bspw. eine Situation mit Bezug zur Eingliederungshilfe nach dem SGB XII.
Fall für
diese Dimension bezieht sich auf die Kontextabhängigkeit: Sozialpädagogisch-sozialarbeiterische Fälle sind oft davon gekennzeichnet, dass sie auch in die Handlungsbereiche anderer Zuständigkeiten und Professionen (z. B. Ärzt:innen, Therapeut:innen, Polizei, Justiz usw.) hineinreichen. Hier geht es auch um die Grenzen der eigenen Zuständigkeit der Professionellen wie auch um Kooperation. Das heißt, bei der Bearbeitung eines Falls ist zu erkennen, welche anderen Instanzen für diesen Fall relevant sind und was das für die Klientel und den eigenen Umgang mit dieser bedeutet.
Fall mit
bezieht sich auf die Beziehungsdimension, also die direkte Arbeit mit der Klientel und damit auf den Kern pädagogischen Handelns. Dabei geht es um die Wechselseitigkeit der Beziehung: Was mache ich, als professionelle Person mit den Personen, um die es geht? Und was machen diese mit mir? Hier liegt die Annahme zu Grunde, dass Fälle nur gemeinsam bearbeitet werden können und es folglich ein zentraler Teil dieser Form von Fallarbeit ist, die gemeinsame Arbeit mit der Klientel zu gestalten.
Ergänzend zu den drei Dimensionen gibt es ein zirkuläres Schema der Fallbearbeitung:
Anamnese
Vorinformationen werden zusammengetragen, vorschnelle Einordnungen und Deutungen sollen vermieden werden.
Evaluation
Reflexion der Wirksamkeit und Ergebnisse der Fallarbeit: Was wurde erreicht, welche Wirkungen sind zu beobachten?
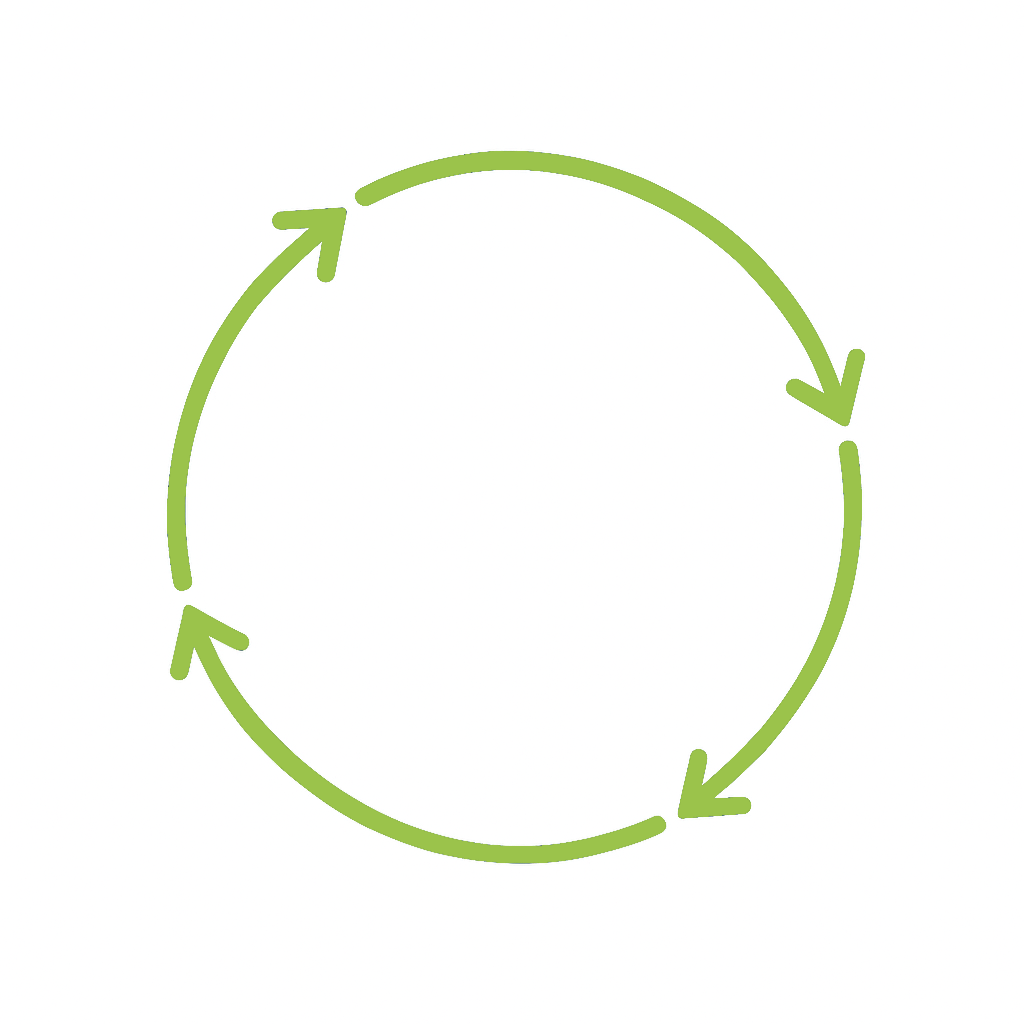
Diagnose
Bestimmung des Problems aus verschiedenen Perspektiven: Wer konstruiert welches Problem, auf welcher Grundlage?
Intervention
Dieser Schritt umschreibt das ‚Einmischen‘ der professionellen Person ‚in den Fall‘. Es geht um die Entwicklung eines professionellen Handlungsplans. Dabei wird die Klientel unterschiedlich stark mit eingebunden.
Kollegiale Fallarbeit
Ein Format, welches kombinierbar mit dem vorgestellten Konzept multiperspektivischer Fallarbeit ist und einen interventionslogischen und praxisorientierten Zugang zu dem jeweiligen Fall fokussiert, ist die kollegiale Fallarbeit.
Unter diesem Stichwort lassen sich Formate kasuistischen Arbeitens subsumieren, die im Sinne klient:innenorientierter Kasuistik einen Fall aus der Praxis zum Gegenstand machen. Ziel ist es, mittels neuer Perspektiven durch kollegiale Reflexion problemlösend Fallberatung vorzunehmen. Neben der Problemlösung geht es auch um die Entwicklung von Handlungskompetenz.
Üblicherweise ist eine der analysierenden Personen selbst in die pädagogische Handlungspraxis involviert. Oftmals sind Formate kollegialer Fallarbeit entsprechend in der pädagogischen Praxis selbst angesiedelt, können aber ebenso in einem erprobenden und gedankenexperimentellen Rahmen im Studium angewendet werden.
Typischerweise folgt die Besprechung des Falls entlang einer bestimmten Gesprächschoreografie, die z. B. verschiedenen Rollen berücksichtigt, wie die der Fallgeber:in, der Moderator:in sowie der Fallberatenden. Zum methodischen Repertoire können dabei auch konkrete Methoden gehören, die insbesondere in der Sozialen Arbeit und Sozialpädagogik Anwendung finden und dort eng verknüpft mit Beratungsarbeit sind (Hypothesenbildung, Genogrammarbeit, usw.)
Fazit
Kasuistik ist kein einheitliches Verfahren oder Analysezugang, sondern umfasst ein vielfältiges methodisches Repertoire, das je nach Kontext und Zielsetzung unterschiedliche Formen annimmt. Ob in der Lehrer:innenbildung, der sozialpädagogischen Praxis oder in der Forschung: Der Einzelfall ist bedeutsam für professionelles Verstehen, Handeln und Reflektieren und damit zentral für die Entwicklung pädagogischer Professionalität über die unterschiedlichen Berufsfelder hinweg.
Weiterführende Literatur
Systematisierungsangebote zu Kasuistik
Müller, B. (2017).
Müller, B. (2017). Dimensionen von Fällen: Fall von, Fall für, Fall mit. In Sozialpädagogisches Können: Ein Lehrbuch zu multiperspektivischer Fallarbeit (8. Aufl., überarb. von U. Hochuli Freund, S. 43–69). Lambertus-Verlag.
Schmidt, R., Becker, E., Grummt, M., Haberstroh, M., Lewek, T., & Pfeiffer, A. (2019).
Vorschlag für eine Systematisierung kasuistischer Lehr-Lern-Formate in der universitären Lehrer*innenbildung. Fallportal der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
Schmidt, R., & Wittek, D. (2021).
Ziele und Modi von Fallarbeit in der universitären Lehre. In D. Wittek, T. Raabe & M. Ritter (Hrsg.), Kasuistik in Forschung und Lehre: Erziehungswissenschaftliche und fachdidaktische Ordnungsversuche (S. 171–190). Klinkhardt.
Kollegiale Fallarbeit
Ader, S., & Schrapper, C. (Hrsg.). (2022).
Sozialpädagogische Diagnostik und Fallverstehen in der Jugendhilfe. Ernst Reinhardt Verlag.
Sirtl, K. (2021).
Kollegiale Fallbesprechungen als Vorbereitung auf das Arbeiten in (professionellen) Teams? – Über die Implementierung „praxisnaher“ Beratungsmethoden in der Lehrer*innenbildung. In N. Böhme, B. Dreer, H. Hahn, S. Heinecke, G. Mannhaupt & S. Tänzer (Hrsg.), Mythen, Widersprüche und Gewissheiten der Grundschulforschung: Eine wissenschaftliche Bestandsaufnahme nach 100 Jahren Grundschule (S. 477–483). Springer VS.
Was ist ein Fall?
Ebenso vielfältig wie die kasuistischen Arbeitsweisen sind auch die Verständnisse davon, was als Fall gilt.
„Immer entsteht ein Fall erst dann, wenn etwas beobachtet, dokumentiert oder ausgewählt und damit zum Fall gemacht wurde […]. Die Beschreibung und Auswahl von Fällen steht im Zusammenhang mit inhaltlichen Interessen, theoretischen Vorstellungen und den bevorzugten Analyseverfahren.“ (Heinzel, 2021, S. 49)
Ein Fall in der Kasuistik ist nie einfach gegeben – er entsteht durch Auswahl, Deutung und Kontextualisierung. Dabei bildet er stets auch die Perspektive derjenigen ab, die an und mit ihm arbeiten.
Häufig ist der Ausgangspunkt ein Moment des Auf-Fallens: Etwas wird zunächst deshalb zum Fall, weil es von der Norm abweicht und dadurch Aufmerksamkeit erfährt. Ein typisches Beispiel im schulischen Kontext ist das auffallende und abweichende Verhalten von Schüler:innen, das durch Beobachtung und Verschriftlichung zu einem Fall gemacht wird.
Doch gerade auch alltägliche Praxis, die auf den ersten Blick nichts Besonderes erkennen lässt, kann durch eine genaue und meist methodengeleitete Betrachtung zu einem Fall gemacht werden – der auf den zweiten Blick durchaus erklärungsbedürftig und voraussetzungsvoll ist.
Entscheidend ist: Der Fall bildet auch die Perspektive derjenigen ab, die ihn auswählen und analysieren. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Fall bereits in der pädagogischen Praxis entsteht (bei der klient:innenorientierten Kasuistik) oder ob er forschungslogisch hergestellt wird (bei der akteur:innenorientierten Kasuistik): In beiden Formen, liegt immer eine Konstruktion und Deutung durch diejenigen vor, die das Fallmaterial zum Ausgangspunkt ihrer Analyse, Rekonstruktion und Reflexion machen.
Typische Fall-Arten in der Praxis
In kasuistischen Lehrformaten lassen sich typische Unterscheidungen treffen:
Eigene vs. fremde Fälle:
Eigene Fälle
Das Datenmaterial stammt von Personen, die selbst an der Praxis beteiligt sind oder diese beobachtet haben. Typisches Beispiel hierfür sind Daten, die aus studentischen Praktikumssituationen heraus entstehen z. B., wenn Unterricht von Studierenden aufgezeichnet wird und diese später das eigene Handeln beobachten und reflektieren sollen.
Fremde Fälle
Hier wird das Handeln anderer beobachtet und analysiert. Die betroffenen Personen sind an der Erhebung und Auswertung nicht beteiligt.
Reale vs. fiktive Fälle:
Reale Fälle
Als ‚real‘ gelten Fälle, die auf dokumentierter pädagogischer Praxis beruhen – etwa durch Videoaufzeichnungen, Transkripte, Fallakten oder andere Dokumente. Sie sollen den Vollzug der pädagogischen Praxis möglichst genau abbilden
Fiktive Fälle
Hier werden gezielt Fälle erstellt – z. B., um typische Reflexionsgegenstände oder charakteristische Problemsituationen zu bearbeiten. Sie eignen sich gut für eine illustrative Fallarbeit, sind jedoch weniger für rekonstruktive Formate der Kasuistik geeignet, da sie keine empirische Grundlage haben.
Auch die Erhebungsform und daraus resultierend die Materialität der Daten (Video-, Audioaufzeichnung, Protokolle, …) ist bedeutsam dafür, was zum Fall gemacht werden kann.
Weiterführende Literatur
Fallverständnisse und Fallbestimmung
Ader, S., & Schrapper, C. (2022).
„Handwerkszeug und Haltung“ – Fachliche Hintergründe und methodische Zugänge zur Fallarbeit. In S. Ader & C. Schrapper (Hrsg.), Sozialpädagogische Diagnostik und Fallverstehen in der Jugendhilfe (S. 41–97). Ernst Reinhardt Verlag.
Handschke, D., & Hünersdorf, B. (2021).
Der Fall aus der Perspektive der Sozialpädagogik. Fallverstehen als Kristallisationspunkt zwischen Profession, Disziplin und dem Politischem. In D. Wittek, T. Raabe & M. Ritter (Hrsg.), Kasuistik in Forschung und Lehre: Erziehungswissenschaftliche und fachdidaktische Ordnungsversuche (S. 108–124). Klinkhardt.
Hummrich, M., Hebenstreit, A., Hinrichsen, M., & Meier, M. (Hrsg.). (2016).
Was ist der Fall? Kasuistik und das Verstehen pädagogischen Handelns. Springer VS.
Pieper, I., Frei, P., Hauenschild, K., Schmidt-Thieme, B. (2014).
Was der Fall ist: Beiträge zur Fallarbeit in Bildungsforschung, Lehramtsstudium, Beruf und Ausbildung. Springer VS.
Begründung für pädagogische Kasuistik in Studium & Weiterbildung
Die Begründung dafür, in Studium, Aus- und Weiterbildung pädagogischer Berufe Kasuistik einzusetzen, stützt sich auf das ihr zugeschriebenen Professionalisierungspotential. Die Argumentation basiert dabei auf der engen Verschränkung zwischen der Struktur der pädagogischen Handlungspraxis für die ausgebildet werden soll, den Grundannahmen qualitativ-rekonstruktiver Forschung und den daraus resultierenden Potentialen pädagogischer Kasuistik.
1. Struktur pädagogischer Handlungsfelder und Einzelfallbezug
Der Einsatz von Kasuistik in der Lehre begründet sich aus der beruflichen Grundstruktur pädagogischer Arbeitsfelder: Pädagogisches Handeln ist nicht standardisierbar, von Unplanbarkeit geprägt und findet in komplexen sozialen Beziehungen statt. Die Arbeit mit der jeweiligen Klientel ist dabei immer einzelfallbezogen – pädagogisches Handeln muss an die jeweilige Situation angepasst werden, weil es keine allgemeingültigen Handlungsanleitungen oder Lösungswege geben kann.
Diese Grundstruktur macht das Handeln in pädagogischen Berufen ebenso herausfordernd wie das vorbereitende Studium für diese Berufe: Theoretisches Wissen allein reicht nicht aus, um die Herausforderungen und Spannungsfelder der pädagogischen Praxis bewältigen zu können. Erforderlich ist eine reflektierte Urteilskraft, die das konkrete Handeln situationsbezogen ausrichtet. Die Berücksichtigung des Einzelfalls setzt ein abwägendes und reflektiertes Handeln, ebenso wie ein nachträgliches Reflektieren voraus – das ist Teil der zu entwickelnden Professionalität.
Hier setzt kasuistische Lehre an: Sie schafft einen handlungsentlasteten Raum, in dem dokumentierte Fälle aus der pädagogischen Praxis zum Gegenstand des Nachdenkens werden können – losgelöst vom unmittelbaren Handlungsdruck und der situativen Zeitnot der Praxis. Studierende sollen erproben, pädagogische Praxis mehrperspektivisch zu analysieren, theoretische und wissenschaftliche Wissensbestände einzubeziehen und eine reflexive Haltung für ihr zukünftiges professionelles Handeln zu entwickeln.
2. Nähe von qualitativer Forschung und pädagogische Kasuistik
Das Argument, eine methodisch orientierte Auseinandersetzung mit Fallmaterial könne zur Professionalisierung (angehender) Pädagog:innen beitragen, wird durch geteilte Grundannahmen von qualitativer Forschung und pädagogischer Kasuistik gestärkt:
Beide gehen vom Einzelfall als Erkenntnisobjekt aus und betrachten die soziale Wirklichkeit als sinnhaft konstruiert. Damit ist gemeint, dass die soziale Wirklichkeit – also die Welt der gemeinsamen Bedeutungen, Normen und unausgesprochenen Regeln – nicht objektiv existiert wie ein Naturgesetz. Vielmehr wird sie von den beteiligten Akteur:innen in ihren alltäglichen Interaktionen durch Sprache und Handeln fortlaufend hervorgebracht. Jede (pädagogische) Situation ist somit bereits eine ‚vorinterpretierte‘ Realität und als Konstruktion zu verstehen: Wir begegnen ihr nie neutral, sondern immer schon durch die Brille unserer kulturellen Annahmen, Erwartungen und sozialen Rollen.
In der qualitativen Forschung ist es Ziel, diese subjektiven Konstruktionen, dahinterliegende handlungsleitende Muster und strukturellen, sozialen Bedingungen zu re-konstruieren, um zunächst ‚fremde‘ Perspektiven verstehbar zu machen. Dabei geht es nicht nur um den Nachvollzug der subjektiven Wirklichkeitskonstruktion, sondern auch deren soziale Entstehungskontexte.
Für die pädagogische Praxis ist diese Vorgehensweise ebenfalls bedeutsam, jedoch mit einem anderen Fokus: Um das Handeln der Klientel verstehen und angemessene Interventionen gestalten zu können, ist es notwendig, deren subjektiv sinnhafte Wirklichkeitskonstruktion nachzuvollziehen und anzuerkennen. Dabei ist es eine Grundprämisse, zunächst das Handeln als subjektiv sinnhaft anzunehmen.
Insofern arbeiten Forschung und pädagogische Praxis auf einer geteilten erkenntnistheoretischen Grundlage: Zwischen dem Besonderen des Einzelfalls und allgemeinen Strukturen wird ein dynamisches Wechselverhältnis angenommen. Ohne den vorliegenden ‚Fall‘ vorschnell in vorgegebene Deutungsmuster einzuordnen, soll die Hervorbringungspraxis und die dahinterliegenden Muster und Einbettungen in Kontexte berücksichtigt werden.
Die qualitative Forschung zielt primär auf Theoriebildung.
Sie will aus dem Fall lernen, um Aussagen über soziale Phänomene zu treffen.
Pädagogische Kasuistik fokussiert hingegen primär auf Professionalisierung und Handlungsfähigkeit.
Sie will am Fall lernen, um die reflexive – und wissenschaftlich fundierte – Urteilskraft für das zukünftige komplexe Berufshandeln zu erproben.
Fallarbeit wird oftmals als Verbindungsglied zwischen sozialwissenschaftlicher Forschung und der pädagogischen Praxis gedacht, da die erläuterten Gemeinsamkeiten auch für kasuistisches Arbeiten relevant sind. Theorie und Empirie sind wechselseitig aufeinander bezogen und tragen gemeinsam zu Erkenntnisbildung und Verstehen bei.
3. Beobachten, Verstehen und Reflexivität
Als weitere Gemeinsamkeit von qualitativ-rekonstruktiver Forschung und pädagogischer Praxis – und damit als eine Begründungsfigur für Kasuistik – können Beobachten, Verstehen und Reflexivität angeführt werden.
Beobachten: Beobachten ist eine zentrale Fähigkeit, um zunächst wahrzunehmen, was überhaupt geschieht. Unterschieden werden können unterschiedliche Beobachtungsformen – ein alltägliches Beobachten, pädagogisches Beobachten und wissenschaftliches Beobachten.
Verstehen: Verstehen umfasst hier als Oberbegriff ein ganzes Spektrum an interpretativen Praktiken: Deuten, Analysieren, Interpretieren, Erschließen, in Beziehung setzen, Rekonstruieren usw.. Ziel ist es, die innere Logik eines Falls und dessen Gewordensein zu erschließen. Dies ist sowohl für wissenschaftliche Erkenntnis- und Theoriebildung als auch pädagogisches Handeln bedeutsam.
Reflexivität: Reflexivität gilt als eine Schlüsselkompetenz professioneller pädagogischer Akteur:innen. Sie erfordert, das eigene Verstehen zu hinterfragen, die eigenen Vorannahmen und Deutungsmuster zu erkennen und zu relativieren. Wer fallbezogen arbeitet, setzt sich nicht nur mit dem Fall auseinander, sondern auch mit dem eigenen Verhältnis zum Fall. Die bewusste Perspektivierung und das Offenhalten alternativer Deutungen sind konstitutiv für reflexives Handeln. Gerade die Komplexität pädagogischer Handlungsfelder – die Ungewissheit, die Bedeutung des Einzelfalls usw. – unterstreicht den Stellenwert der Reflexionskompetenz, die bereits vorab in der Fallarbeit erprobt werden kann.
Fazit
Das besondere Professionalisierungspotenzial kasuistischer Arbeit liegt darin, dass sie es ermöglicht, pädagogisches Handeln jenseits akuten Entscheidungsdrucks zu analysieren und die zugrundeliegenden Herausforderungen für das Handeln der Akteur:innen zu erschließen. Dies geschieht in einer Weise, die die Komplexität realer Situationen, subjektive Sinnstrukturen und soziale Rahmungen gleichermaßen berücksichtigt.
Weiterführende Literatur
Dinkelaker, J., Hugger, K.-U., Idel, T.-S., Schütz, A., & Thünemann, S. (2021).
Professionalität und Professionalisierung in pädagogischen Handlungsfeldern: Schule, Medienpädagogik, Erwachsenenbildung. Verlag Barbara Budrich.
Helsper, W. (2021):
Professionalität und Professionalisierung pädagogischen Handelns: Eine Einführung. Verlag Barbara Budrich.
Porsch, R., Leonhard, T., Luttenberger, S., & Kopp-Sixt, S. (Hrsg.). (2025).
Handbuch Professionalisierung pädagogischer Praxis. Waxmann.
Beck, C., Helsper, W., Heuer, B., Stelmaszyk, B., & Ullrich, H. (2000).
Fallarbeit in der universitären LehrerInnenbildung: Professionalisierung durch fallrekonstruktive Seminare? Eine Evaluation. Leske + Budrich.
Schmidt, R., & Wittek, D. (2021).
Ziele und Modi von Fallarbeit in der universitären Lehre. In D. Wittek, T. Raabe & M. Ritter (Hrsg.), Kasuistik in Forschung und Lehre: Erziehungswissenschaftliche und fachdidaktische Ordnungsversuche (S. 171–190). Klinkhardt.
Praxis der Fallarbeit
Kasuistisches Arbeiten kann eine Vielzahl konkreter Formate und Vorgehensweisen umfassen. Im Folgenden wird ein Überblick über typische Schritte gegeben, die Fallarbeit kennzeichnen.
Die Praxis der Fallarbeit lässt sich grundsätzlich in drei zentrale Handlungsschritte unterteilen. Diese gelten unabhängig davon, ob es sich um erziehungswissenschaftlich-fachdidaktische oder sozialpädagogische Kasuistik handelt und ob der Zugang eher rekonstruktiv, illustrativ oder anders ausgerichtet ist.
Nicht alle diese Handlungsschritte müssen Bestandteil kasuistischen Arbeitens sein. Sie bilden jedoch die Grundlage eines umfassenden Prozesses. Je nach Zielsetzung und Format der Fallarbeit können auch einzelne Elemente in die Lehre integriert werden. Wie intensiv die jeweiligen Schritte in der Lehre eingesetzt werden, hängt von der didaktischen Einbettung und dem geplanten Lehrkonzept ab.

- Erhebung von Daten: Im ersten Schritt werden Daten erhoben, die später die Grundlage der Fallarbeit bilden. Dies geschieht in der Regel durch Beobachtungen und Aufzeichnungen der pädagogischen Praxis.
- Aufbereitung von Daten: Anschließend werden die Daten aufbereitet – z.B. indem aus Notizen Protokolle oder aus Audiodaten Transkripte erstellt werden.
- Auswertung von Daten: Die Art und Weise, wie mit den Daten gearbeitet wird – also wie Praktiken des Verstehens, Deutens, Interpretierens oder Rekonstruierens vollzogen werden – variiert sehr stark. Je nach Auswertungsmethode kann der Zugang eher forschungsorientiert oder praxisorientiert sein. Auch die hochschuldidaktische Anleitung und Aufbereitung, wie am Fallmaterial gearbeitet werden soll, ist sehr unterschiedlich.
Hinweis:
Weitere Informationen zu den zentralen Handlungsschritte, methodische Unterstützung sowie Praxismaterial werden zeitnah bereit gestellt.
Verfasserin: Cornelia Jacob
Zitiervorschlag: Jacob, Cornelia (2025): Praxis & Wissen. Hallesches Fallportal. URL: https://fallportal.zlb.uni-halle.de/praxis-wissen/
Hinweise, Rückfragen oder Ergänzungsvorschläge können gerne an fallportal[at]zlb.uni-halle.de gesendet werden
